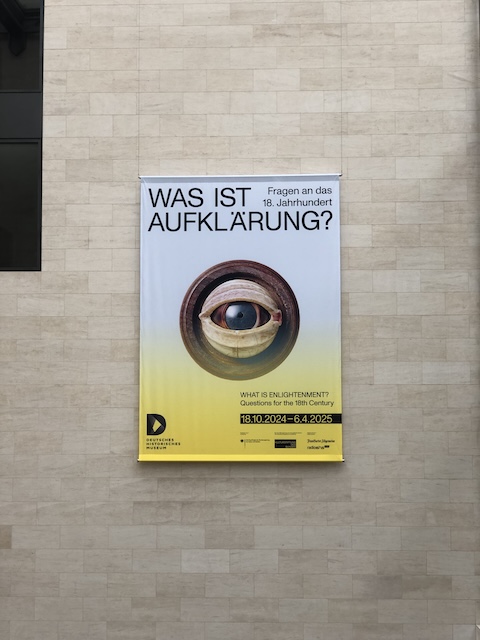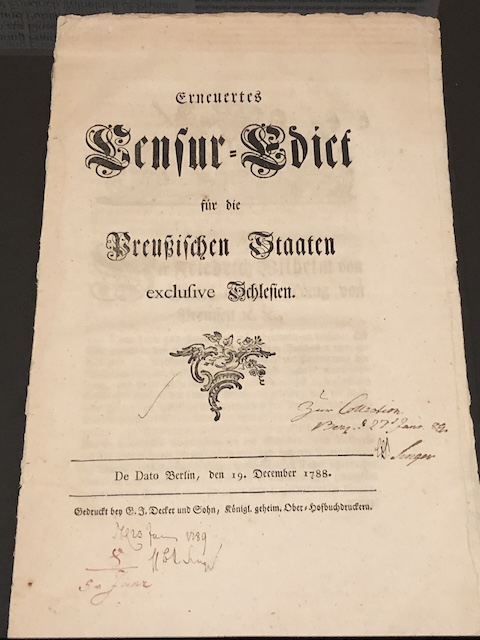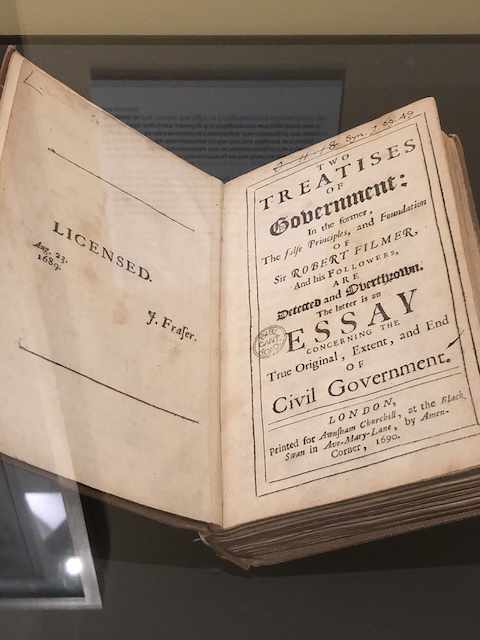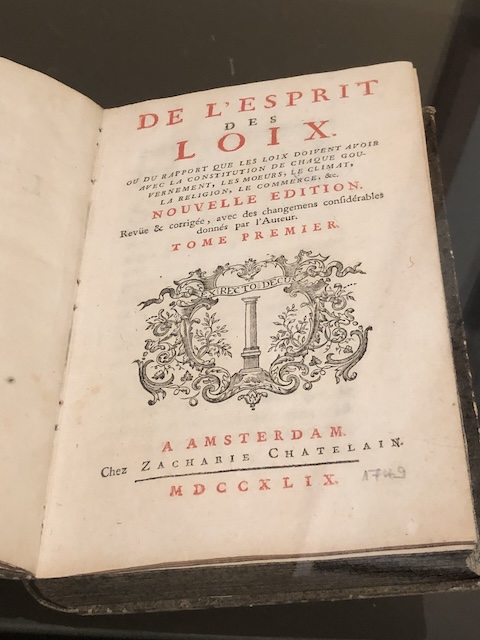Zwei Sonnenkönige an entgegengesetzten Polen der Welt lernten voneinander – zum Nutzen beider Staaten und Völker.
Trinks, Stefan, 2025, Sonnenkönig in Chinas Schatten. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Samstag, 4. Januar 2025, S. 9.
Mit keinem treffenderem Schlusswort hätte FAZ-Korrespondent Stefan Trinks seinen Bericht zur Ausstellungseröffnung »Die Verbotene Stadt und der Palast von Versailles« im Hongkonger Palace Museum in der Samstagsausgabe der FAZ (4. Januar 2025) schließen können. Austausch statt Decoupling!

Die Ausstellung im fernen Hongkong präsentiert anhand von mehr als 150 Exponaten den kulturellen Austausch zwischen dem absolutistischen Frankreich unter Ludwig XIV. und dem vierten Kaiser der Qing-Dynastie, Kangxi. Und einigermaßen spektakulär ist für europäische Ohren die Schlussfolgerung, dass
der gesamte französische Staat unter Ludwig XIV [mehr oder weniger] eine Kopie des chinesischen Kaisertums [ist!].
Trinks, 2025, S. 9
Die Form seines Absolutismus, seine Stilisierung zum Sonnenkönig, die Ballung der Macht in einem Palast, […] vor allem aber die Konzentration aller Adeligen [an einem Ort] – all das sind Übernahmen vom Kaiserhof Chinas [!]
ebd.
Unzählige Könige, Fürsten und Grafen in ganz Europa eiferten Sonnenkönig Ludwig XIV in seinem Herrschaftsmodell und vor allem seinem Schloss Versailles nach – und dieser hat sich alles vom Kaiser von China abgeschaut. Am offensichtlichsten wird dies beim Vergleich der verbotenen Stadt in Beijing mit dem Schloss Versailles.

China und die europäischen Aufklärer
Kaiser Kangxi war der vierte Herrscher der ursprünglich manjurischen Qing-Dynastie, die 1636 gegründet wurde und ab 1644 die Hauptstadt Beijing eroberten (Vogelsang, Kai, 82023, Geschichte Chinas. Reclam, S. 402-403.).
Dass sich gebildete Köpfe in Europa im 17. und 18. Jahrhundert für China begeisterten, ist nichts Neues. Jeder aufmerksame Spaziergänger im Potsdamer Park Sanssouci wird staunend den chinesischen Tee-Pavillon mit seinen vergoldeten asiatischen Figuren und Früchten bewundern. Friedrich II. veröffentlichte 1760 eine satirische Schrift zu China. Und jeder namhafte Aufklärer tat es ihm gleich. Kant pries das Reich der Qing-Dynastie als »kultiviertestes Reich der Welt«; Voltaire bezog sein Wissen über China aus jesuitischen Schriften und bewunderte Konfuzianismus und chinesische Kultur.
Kai Vogelsang hält die Begeisterung der europäischen Aufklärer für China allerdings für ein »gegenseitiges Missverständnis« (Ebd., S. 428). Seine Begründung: Europa verklärte China, weil es soweit entfernt war. Aus sicherer Distanz sei es für Montesquieu, Kant und Voltaire leicht gewesen, China als Land der Philiosophen-Kaiser zu bewundern.
Die Ausstellung in Hongkong zeigt indes ein anderes Bild: nicht Missverständnis, sondern handfester Austausch waren die Handlungsmaxime. Dabei war der Austausch etwa zwischen Frankreichs Ludwig XIV und Kangqi »keine Einbahnstraße«, [sondern] vielmehr ein gegenseitiges Nehmen und Geben«. Kanqxi und seine Nachfolger wollten auch vom Westen lernen, sie studierten das Dezimalsystem und sammelten wissenschaftliche Instrumente (Trinks, a.a.O.). Jesuiten-Missionäre bildeten in vielen Fällen den physischen Mittler, den Austausch und Netzwerkbildung benötigt.
Es ist äußerst lobenswert, dass die FAZ über diese aktuelle Ausstellung berichtet. Denn sie lenkt den Blick auf eine fruchtbare Epoche der Beziehungen zwischen China und Europa, als jene der imperialen Ausbeutung ab dem 19. Jahrhundert.
Herrschaft im Porträt: Umsetzung im Geschichtsunterricht
Geht es nach dem offiziellen Rahmenlehrplan in Brandenburg, lernen die Schüler nichts über Kultur und Gesellschaft Chinas. China taucht entweder auf als »Opfer« des westeuropäischen Imperialismus auf (Klasse 9), oder als »Diktatur« unter Mao und Akteur im Kalten Krieg (Klasse 12).

Ludwig XIV lernen die Schüler idealerweise in Klasse 8 in Vorbereitung auf die Französische Revolution kennen. Als Bildquelle interpretiert wird dabei klassischerweise das Staatsporträt des Sonnenkönigs im Hermelinmantel (»Herrschaft im Porträt«).
Das ist zwar schön und gut, ist aber eine sehr enge Sicht auf die westeuropäische Welt. verstetigt aber nur die eurozentrische Sicht in der historischen Bildung.

Bringen Sie also etwas China in den Lernraum! Lassen Sie die Schüler doch mal das Porträt des französischen absolutistischen Regenten mit dem des chinesischen vergleichen. Ein Unterschied liegt darin, dass »Ludwig sich dynamisch im Dreiviertelporträt dreht, während der Kaiser von China ausschließlich im strengen en face frontal abgebildet werden musste«. (Trinks, a.a.O.). Denn die beiden Gesichtshälften mussten symmetrisch sein, auf keine Stelle im Gesicht durfte ein Schatten fallen. Wenn Sie dann noch die Karte »Das China der Qing-Dynastie (17.–19. Jh.)« aus Christian Grateloups grandiosem Historischem Atlas »Geschichte der Welt« zeigen, ist schon viel an kulturellem Verständnis für das Reich der Mitte gewonnen.